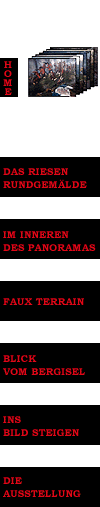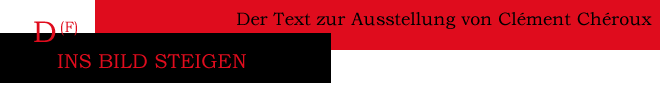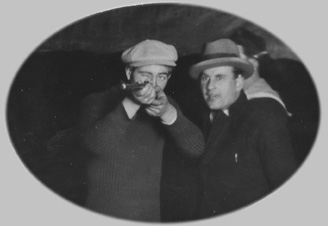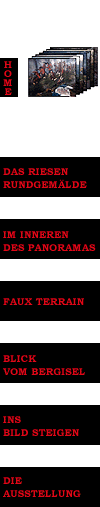Die Erinnerung ist nur sehr vage. An den fotografischen Schießstand erinnere ich mich kaum, außer an den harten Detonationsknall, auf den manchmal ein blendendes Blitzlicht folgte. Beim Wiederlesen von Michel Butors Text L'Emploi du temps1 tauchten die Details dieser merkwürdigen Volksfest-Attraktion mit der Eindringlichkeit wiederkehrender Erinnerungen in mir auf. Ich sah die auf die Schießbudentheke gestützten Schützen ihr Gewehr langsam anlegen, sich konzentrieren, zielen und dann schießen. Ich erinnere mich auch, daß sie bei einem Treffer ins Schwarze ein fotografisches Dispositiv auslösten, durch das sie im selben Augenblick mittels eines Magnesiumblitzes fixiert wurden. Ihr Schützen-Porträt durften sie als Trophäe mit nach Hause nehmen. Wenn ich heute die Bilder von damals betrachte, die erhalten geblieben sind, während es die Attraktion selbst längst nicht mehr gibt, komme ich beim Anblick meines Schützen-Porträts um ein gewisses Unbehagen nicht umhin. Durch das fotografische Dispositiv bin ich zur Zielscheibe geworden.
Ein ähnliches Gefühl empfand ich bei meinem ersten Besuch im Innsbrucker Panorama, das die Schlacht vom 13. August 1809 zur Verteidigung der Unabhängigkeit Tirols darstellt. Auf dem Bergisel, in der Nähe des Ortes, von wo aus Andreas Hofer und seine Berater die Offensive führen, liegen hinter einem Zaun einige Schützen auf der Lauer und richten ihr Gewehr auf einen vermeintlichen Feind, der niemand anderer ist als der Betrachter. Unter ihren Gewehrsalven werde ich in die Offensive hineinkatapultiert und befinde mich so inmitten des Schlachtfeldes: abermals werde ich zur Zielscheibe. Wie beim Blick der Mona Lisa bleibe ich in ihrer Zielrichtung, wohin auch immer ich mich in der Rotunde stelle. Der dadurch ausgelöste Effekt ist besonders paradox. Die auf mich zielenden Schützen ziehen mich ins Bild hinein und halten mich doch gleichzeitig durch ihre Waffen auf Distanz. Die Absperrung, hinter der sie sich befinden, scheint mich ebenfalls daran erinnern zu wollen, daß auch ich hinter einer ähnlichen Balustrade stehe. Im abgeschlossenen Raum der Plattform bin ich also zwar im Zentrum des Bildes, der Zugang zu ihm bleibt mir aber verwehrt. Im optischen Dispositiv des Panoramas komme ich mir vor wie in einem Zugabteil: ich genieße die vor meinen Augen vorbeiziehenden Szenen, nie aber kann ich hinaussteigen, um die an den Geleisen wachsenden Blumen zu pflücken. Ich befinde mich im Zentrum des Bildes, ohne jedoch im Bild selbst zu sein.
"Ich stehe am Rande des Abgrunds, falle aber nie hinunter", meinte Paul Gauguin.2 Ich befinde mich am Rande des Bildes, aber niemals komme ich hinein, ist der Betrachter des Panoramas zu sagen geneigt. Hinter die Balustrade gesperrt und zugleich von einigen beunruhigenden Schützen bedroht, ist es mir tatsächlich unmöglich, ins Bild hineinzusteigen. Ein für allemal wird mir die Rolle im Zentrum des Panoramas - im "Auge des Dispositivs" - zugewiesen. Im Patent des Iren Robert Barker zur Errichtung des ersten Panoramas betont dieser im übrigen die Bedeutung genau jener Betrachter-Position für die Illusionsbildung: "Eine innere Absperrung ist in der genannten Konstruktion notwendig [...], die den Betrachter daran hindern soll, sich zu sehr an die Zeichnung oder das Gemälde anzunähern, so daß sie/es ihre/seine Wirkung von jedem Standpunkt aus, von dem sie/es zu betrachten ist, entwickeln kann."3 Im Bewußtsein dieses Hindernisses hat Arno Gisinger genau das getan, wovon jeder Betrachter einmal träumt: er ist über die Barriere gesprungen und ins Bild gestiegen, um es aus der Nähe zu betrachten. Was entdeckte er nun hinter dem Spiegel? Nicht nur eine andere Realität wie Alice im Wunderland, sondern gleich zwei andere Realitäten, oder vielmehr zwei andere Abbilder: das Gemälde und das Faux Terrain. Von der Plattform aus betrachtet, wird die Illusion durch die geschickte Kombination dieser beiden Darstellungsebenen (die zweidimensionale Leinwand und der dreidimensionale Vordergrund) aufgebaut. Indem er so ins Bild hineinsteigt, hebt Arno Gisinger den perspektivischen Prozeß auf, der eigentlich vom Zentrum aus hergestellt werden sollte. Er bricht die Illusion und enthüllt den Kunstgriff.
|
|
Die von dieser Reise ins Land der Illusionen mitgebrachten Fotografien führen eine unbekannte Welt von anamorphen Wesen und eigentümlichen Objekten vor. Ein Schuh, eine Fahne, ein Gewehr und ein Hut - lauter Objekte, die hier wie dort wie Symbole plaziert zu sein scheinen. Die am Übergang zwischen Gemälde und Faux Terrain aufgenommenen Bilder zeigen den Bruch des perspektivischen Raumes. Sie akzentuieren das, was das panoramatische Dispositiv zu verstecken beabsichtigt, und machen so die Konstruktion der Illusion augenscheinlich. Die Arbeiten von François Robichon und Bernard Comment über das Panorama4 - beide inspiriert von Michel Foucaults Theorien - machen deutlich, wie die Inszenierung der Darstellung zu einer ganz bestimmten Sichtweise der historischen Ereignisse zwingt, wie sehr die Konstruktion der Illusion auch eine Konstruktion von Geschichte ist. In diese Denkrichtung lassen sich Arno Gisingers fotografische und theoretische Fragestellungen einordnen. Wie bereits in seinen früheren Arbeiten Oradour sur Glane. Archäologie der Erinnerung und Messerschmitthalle5 geht es ihm um das Aufzeigen der Mechanismen von Geschichtskonstruktion. Eine Geschichte, die doch eigentlich gut geschützt war, die zu ihrer Verteidigung einige bedrohlich wirkende Soldaten, Hüter der Illusion, Wächter der Trugbilder aufgestellt hatte.
Aus dem Französischen von Andrea Oberhuber
Fußnoten:
1. Michel Butor, L'Emploi du temps, Paris, Minuit, 1956.
2. Paul Gauguin, Lettre de juin 1892, in: Lettres de Gauguin à Daniel de Monfreid, Paris, Georges Falaize, 1950, S. 58.
3. Robert Barker, Brevet déposé en date du 19 juin 1789, zit. nach: Bernard Comment, Le XIXe siècle des panoramas, Paris, Adam Biro, 1993, S. 108.
4. François Robichon, Le Panorama, spectacle de l'histoire, in: Le Mouvement social 131 (April-Juni 1985), S. 65-86; Bernard Comment, op. cit.
5. Arno Gisinger, Messerschmitthalle. Oradour. Ausstellungskatalog der Klangspuren '95, Schwaz / Tirol 1995.
|